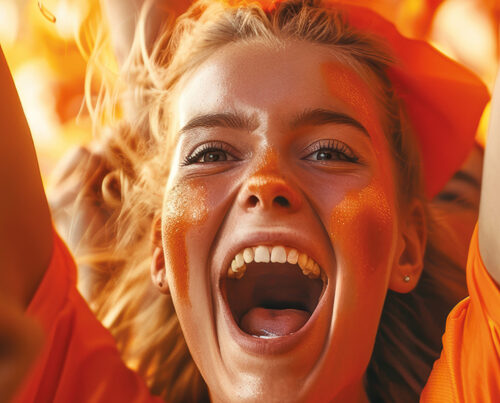Veränderte Stoffströme und größere Materialvielfalt
Die modernen Verfahren und digitalen Prozesse von Industrie 4.0 haben weitreichende Auswirkungen auf die Kreislaufwirtschaft. Hierzu gehört, dass sich Unternehmen der Recyclingindustrie intensiv mit erheblich veränderten Stoffströmen und einer deutlich größeren Vielfalt an Materialien befassen müssen. Für die umfassender und anspruchsvoller werdenden Aufgaben nutzt die Branche verstärkt innovative Methoden und Techniken.
Konventionelle Verfahren stoßen an Grenzen
Von der Konzeption und Entwicklung über die Fertigung, Nutzung und Wartung bis zum Recycling: Mit den intelligenten und digital vernetzten Systemen von Industrie 4.0 lassen sich ganze Wertschöpfungsketten optimieren und komplette Produktlebenszyklen unterstützen. Neue Produktionstechnologien ermöglichen dabei eine stärkere Miniaturisierung der eingesetzten Materialien. Zusätzlich entstehen immer mehr sehr heterogene Kombinationen aus einer Vielzahl verschiedener Stoffe. Konventionelle Recyclingverfahren stoßen hierdurch bei der Materialtrennung zunehmend an die Grenzen des technisch und wirtschaftlich Machbaren. Für die Praxis bedeutet das: Gemeinsam mit Industrie 4.0 muss sich auch eine Kreislaufwirtschaft 4.0 entwickeln, einschließlich Smart Recycling.
Recyclingfähigkeit der Produkte sichern
Exemplarisch für die zunehmende Materialvielfalt und Komplexität sind die Entwicklungen bei der Elektromobilität. Dort werden Kunststoffe für den Leichtbau von Elektrofahrzeugen strukturverstärkend um Glas- oder Kohlenstofffasern ergänzt. Dies hat zur Folge, dass die neuen Verbundmaterialien nach der klassischen künftig auch eine zusätzliche Spezialaufbereitung benötigen. Ähnlich ist die Situation bei Windkraft- und Solaranlagen, wo es noch etliche unbeantwortete Fragen zur geeigneten Verwertung gibt.
Ein Ziel von Industrie 4.0 ist es, Kunden und Geschäftspartner stärker in die Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse einzubinden.
Im Hinblick auf den fundamentalen Wandel der industriellen Produktionstechnologien ist das Recycling gefordert, mit flexiblen Aufbereitungsverfahren auf die schnellen Änderungen zu reagieren. Dabei geht es zum einen darum, den veränderten Inputmengen gerecht zu werden. Zum anderen müssen aber auch die per Recycling gewonnenen Rohstoffe den Anforderungen der Abnehmer entsprechen. Hierfür gilt es, in der Wertschöpfungskette vor allem höhere Trenntiefen und -schärfen bei der Sortierung von Materialien zu erreichen. Gute Ansatzpunkte dazu bieten moderne sensorbasierte Sortierverfahren, die eine schnelle und zuverlässige Materialerkennung ermöglichen. Unerlässlich ist auch ein frühzeitiger Dialog mit der herstellenden Industrie. Dadurch lassen sich nicht nur Fragen zur späteren Rohstoffaufbereitung klären, sondern zugleich wichtige Beiträge für die Entwicklung gut recyclingfähiger Produkte erbringen.
Umweltfreundliche Transporte mit Gas- und Elektroantrieb
Auch im Bereich der Logistik müssen für eine Kreislaufwirtschaft 4.0 zukunftsweisende Lösungen entstehen. Mit dazu gehört der Einsatz umweltschonender Nutzfahrzeuge, die per Erdgas, Biogas oder Batterie betrieben werden. Sie bieten Alternativen zu herkömmlichen Dieselfahrzeugen und überzeugen als technologische Antwort auf strengere Vorgaben für den innerstädtischen Verkehr. So setzt REMONDIS ab Mitte dieses Jahres in Nordrhein-Westfalen sechs hochmoderne gasbetriebene Sammelfahrzeuge ein. Sie fahren mit Biogas und ermöglichen somit eine nahezu klimaneutrale Abfuhr. Weitere Vorteile der umweltfreundlichen Fahrzeuge sind sehr geringe Emissionen und ein geräuscharmer, wirtschaftlicher Betrieb.
Für die Praxis bedeutet das: Gemeinsam mit Industrie 4.0 muss sich auch eine Kreislaufwirtschaft 4.0 entwickeln, einschließlich Smart Recycling.
Elektro-Nutzfahrzeuge mit Roboterunterstützung
Parallel engagiert sich REMONDIS auch im Bereich E-Mobilität. Die zur REMONDIS-Gruppe gehörende Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft BEG, der Fahrzeughersteller FAUN Umwelttechnik und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz arbeiten gemeinsam an einem komplett elektrisch betriebenen Sammelfahrzeug. Das Projekt mit dem Titel „BEAR – Batterieelektrische Abfallentsorgung mit Roboterunterstützung“ wird vom Bundesumweltministerium gefördert. Ein Prototyp des Fahrzeugs ist auf der IFAT 2018 zu sehen. Direkt nach der Messe erprobt die BEG das Versuchsfahrzeug mindestens zwölf Monate lang im Realbetrieb. Angestrebt sind eine Batterielebensdauer von mindestens acht Einsatzjahren und ein weitestgehend autonomes Ladeverfahren durch den Einsatz von Robotern. Erkenntnisse aus dem Projekt sollen später auch auf elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge anderer Branchen übertragen werden.

Bildnachweise: Bild 1, 2: iStock,from2015